Wie wahr?
Britische Diskussion über TV-Authentizität.
Es klang zunächst wie der aufgeblasenste Medienskandal des britischen Sommerlochs: In einem Trailer für eine BBC-Dokumentation schien es, als würde die Königin aus einer Foto-Session mit Annie Leibovitz herausstürmen. In Wirklichkeit war die Reihenfolge zweier Szenen vertauscht, und die Königin war tatsächlich zur Fotografin unterwegs.
Aber in Kombination mit dem Anrufquiz-Skandal vom Frühjahr ist daraus eine kleine Lawine geworden. Die BBC hat weitere Sendungen überprüft und dabei eine Reihe von Fällen entdeckt, in denen Produktionsmitarbeiter so getan hatten, als seien sie Anrufer. Die Branche rechnet offenbar damit, dass weitere Fälle auftauchen. Reaktion der BBC: Keine Anrufquizze mehr, Schulungen für die Mitarbeiter und einige Beurlaubungen, die Medienberichten zufolge wohl bis in die mittlere Managementebene gehen.
Und jetzt geht es langsam ans Eingemachte: Wie viel Wirklichkeit verträgt das Fernsehen? Wie entsteht, um in Großbritannien zu bleiben, eine Sendung wie Holiday Showdown, in der zwei inkompatible Familien zusammen zwei Wochen Urlaub machen, und das von den entstehenden Konflikten lebt? Etwa, wie es im Observer heißt, durch Lügen beim Anwerben der Teilnehmer und zusätzliche Stressfaktoren „like leaving them hungry“? Was ist mit Zwischenschnitten in Nachrichtenbeiträgen, mit dem Politiker, der für die Kamera den Flur entlanggeht und mit Papier raschelt, mit dem abgefilmten Faxgerät, aus dem angeblich just eine Pressemitteilung quillt?
Ist das Publikum mittlerweile so medienerfahren, dass es gestellte Szenen und andere Schummeleien erkennt? Wenn ja, sehen die Zuschauer darüber hinweg oder ärgern sie sich? Welche Rolle spielen YouTube & Co.? Welchen Effekt haben die kleinen, handlichen, günstigen Digital-Video-Kameras — werden TV-Reporter damit wieder mehr Beobachter als Regisseure des Geschehens? Der bloggende Chef der BBC-Abteilung Global News, Richard Sambrook, erwartete schon vor dem Ärger um den Queen-Trailer einen baldigen Wandel im Nachrichtengeschäft: „I suspect that the current push towards transparency and openness, coupled with the raw authenticity of new video techniques, driven by cheap ubiquitous cameras and outlets like YouTube will mean before too long these techniques will start to look as dated as Walter Cronkite’s tweed suit.“
- Fragen und Antworten zu den BBC-Anrufsendungen (BBC)
- Media-Talk-Podcast: BBC in der Krise (Guardian)
- Zur Verteidigung der BBC (The Independent)
- Frühere Quiz-Show-Skandale (Wikipedia)
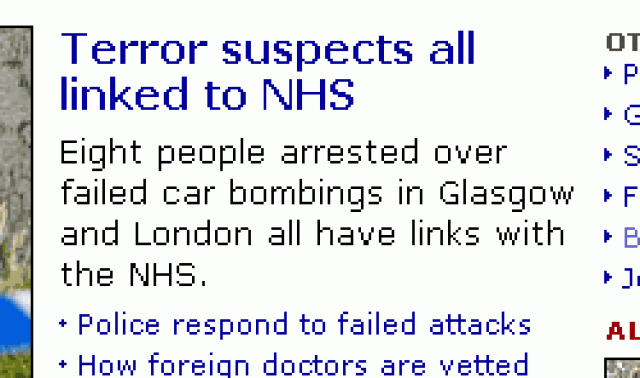
 Auf seiner langen, langen Abschiedstournee hat Tony Blair
Auf seiner langen, langen Abschiedstournee hat Tony Blair