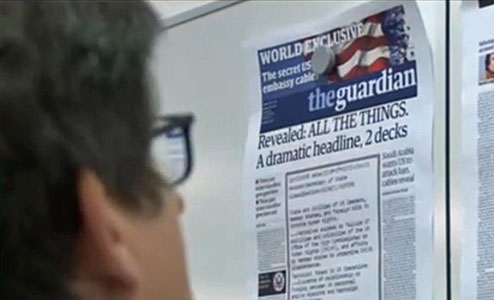ICANN für .xxx
Ende eines jahrelangen Ringens?
Das erste Mal, dass Wortfeld über Pläne für eine .xxx-Domain berichtet hat, ist fast sieben Jahre her. Die Vorgeschichte bis zum Jahr 2006 gibt es an anderer Stelle zusammengefasst. Und jetzt geschieht das Wunder: Das ICANN-Direktorium beschließt die Rotlicht-Domain .xxx.
Das könnte spannend werden – nicht, was die Inhalte unter .xxx angeht, sondern was das für ICANN bedeutet. Das Direktorium der Netzverwaltung hat sich damit über den Rat der Regierungen hinweggesetzt, genauer: des Beratenden Regierungskomitees GAC.
Nicht, dass sich das GAC strikt gegen .xxx ausspricht; das tun einige Regierungen, aber längst nicht alle. 2005 schrieb der GAC-Vorsitzende ans ICANN-Direktorium, es herrsche „a strong sense of discomfort in the GAC“, wenn es um diese Domain gehe. Bis heute blieb die GAC-Kritik schwammig. Der .xxx-Antrag sieht jetzt sogar vor, dass das GAC und die Regierungen kulturell und religiös bedeutende Wörter vorab einreichen können, damit es diese nicht unter .xxx registriert werden können. (Natürlich wird .xxx in einigen Ländern gefiltert werden – das wissen auch diejenigen, die sich eine .xxx-Domain bestellen und nehmen es in Kauf.)
Was passiert also, wenn ICANN die Ratschläge des GAC nicht beherzigt? Diesmal vermutlich wenig. Auch im GAC sind nicht alle gleich – angefangen mit der US-Regierung. Wenn auf der obersten Ebene des Domainnamensystems, in der Rootzone, etwas geändert werden soll, wird das zuerst von der NTIA, einer Behörde des US-Handelsministeriums, überprüft. Ein Veto an dieser Stelle ist also technisch machtvoll, aber zugleich politisch potenziell selbstzerstörerisch: Je stärker und je isolierter die USA davon Gebrauch machen würden, desto stärken würden sich andere Regierungen, Rootserver-Betreiber und Nutzer anstrengen, das bisherige System durch ein anderes ersetzen.
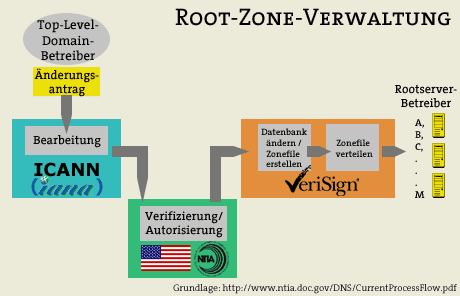
Die US-Regierung hat sich in Sachen .xxx schon einmal eingemischt, auf Druck der religiösen Rechten, und das Verfahren weiter verzögert. Dabei ist die amerikanische Position gar nicht so aufregend: Man will natürlich nicht als Unterstützer von .xxx-Inhalten gelten.
Wenn also alles mit rechten Dingen zugeht, passiert dies: ICANN will .xxx in die Rootzone einfügen, das US-Handelsministerium prüft und stellt fest, dass das korrekte Verfahren eingehalten worden ist, Verisign fügt .xxx in die Rootzone-Datei ein und wenig später ist die Domain sichtbar. Mal sehen, was das für das Verhältnis von ICANN und Regierungen bedeutet.