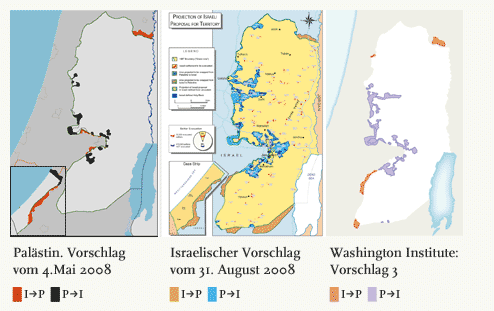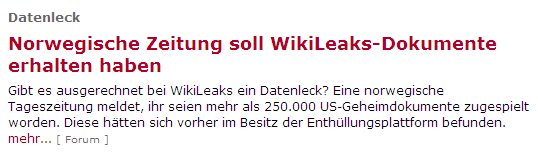Spiegel Online meldet derzeit, dass Aftenposten Zugang zu den 250.000 Botschaftsdepeschen hat, die im Besitz von Wikileaks sind.
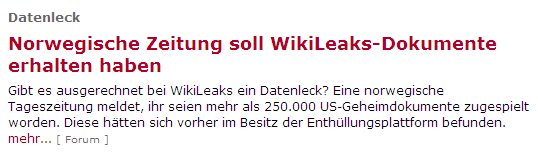
Nun sei die Zeitung möglicherweise „das einzige Medium weltweit, das den kompletten WikiLeaks-Datenbestand veröffentlichen könnte“. Hmmm… das einzige weltweit außer Wikileaks selbst, New York Times, The Guardian, Le Monde, El País und dem Spiegel, oder nicht?
Die norwegische Zeitung hatte schon vor fast einer Woche verkündet, dass auch Aftenposten nun über das komplette Material verfüge und es uneingeschränkt nutzen dürfe. Vorher hatten Aftenposten und Svenska Dagbladet Zugang zu etwa 2.000 Dokumenten erhalten — so viele hat Wikileaks bereits selbst im Web veröffentlicht. Das Blatt hat natürlich nicht vor, den kompletten Datenbestand zu veröffentlichen, sondern macht, was alle anderen beteiligten Medien auch tun: abwägen und ausgewählte Auszüge drucken.
Wikileaks hatte vorher angekündigt, weitere Medienpartner in anderen Ländern zu suchen — bei Aftenposten gibt es nirgends einen Hinweis, dass Aftenposten das Material von irgendwem anders als von Wikileaks selbst erhalten hat. Wäre das so, hätte Aftenposten das mit ziemlicher Sicherheit erwähnt, denn das wäre ja an sich schon eine Sensation. Ausgelöst hat den Spiegel-Online-Bericht wohl eine Meldung der norwegischen Nachrichtenagentur NTB, die sich wiederum auf einen Bericht der norwegischen Wirtschaftszeitung Dagens Næringsliv (DN) beruft. Der interviewte Aftenposten-ChefRedakteur wollte DN die Quelle für die Depeschen nicht nennen. DN schreibt aber, Aftenposten habe den Zugang zu den Dokumenten „ohne Einverständnis von Wikileaks-Chef Julian Assange“ bekommen. Das allein wäre natürlich nicht sehr überraschend, da Assange bekanntlich derzeit ein oder zwei andere Probleme hat.
Bloomberg vermeldet übrigens, dass auch die russische Novaya Gazeta jetzt US-Botschaftsdepeschen von Wikileaks bekommen hat. Allerdings handelt es sich laut Bloomberg um eine Auswahl von Depeschen, die Russland betreffen.
Je mehr Redaktionen bislang unveröffentlichtes Material bekommen, desto höher ist aber natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeine mit den Daten nicht sorgfältig genug umgeht.
Nachtrag 1: Oh, es wird noch interessanter, was Wikileaks und den skandinavischen Raum angeht (via). Derjenige, der bislang den Zugang der skandinavischen Medien zu den Depeschen gefiltert hat, heißt Johannes Wahlström; sein Vater Israel Shamir ist der Wikileaks-Ansprechpartner für die russischen Medien. Israel Schamir wird von Sveriges Radio als berüchtigter antisemitischer Kommentator bezeichnet, in Interviews spricht er von einer „Vergötterung des Holocausts“. Der Guardian-Blogger und Autor Andrew Brown hat ebenfalls etwas zu den merkwürdigen Wikileaks-Repräsentanten geschrieben. Für diese länderspezifischen Enthüllungen spielt Wikileaks also selbst Gatekeeper — eine interessante Konstellation.
Nachtrag 2: Auf einer norwegischen Medienseite gibt es noch ein paar Details: Aftenposten-Redakteur Ole Erik Almslid sagt, dass seine Zeitung den Zugang ohne Verpflichtungen erlangt habe und dafür auch nicht gezahlt habe. Aftenposten müsse weder Artikel schreiben noch die Dokumente im Netz veröffentlichen. (Wikileaks hatte vorher Svenska Dagbladet Material für Skandinavien gegeben und die schwedische Zeitung gab sie an das norwegische Schwesterblatt weiter. Auch dabei sei Svenska Dagbladet keinerlei Absprache mit Wikileaks eingegangen, sagte der SvD-Chefredakteur Mitte Dezember.)
Nachtrag 3: Nun erinnert sich der Spiegel wieder – Spiegel Online hat den Artikel etwas entdramatisiert und so umgeschrieben, dass Aftenposten nicht mehr das weltweit einzige Medium im Besitz aller Depeschen ist.